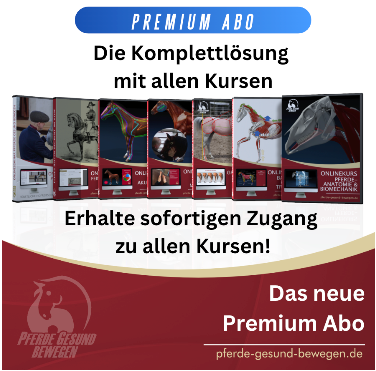Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenWenn Du Dich für die Anatomie und Biomechnik des Pferdes interessierst, dann ist der Onlinekurs Anatomie und Biomechanik genau das Richtige: zum Kurs
Das Nackenrückenband des Pferdes – Anatomie und Biomechanik Die Natur des Pferdes, dessen Anatomie und Biomechanik sollte der maßgebliche Wegweiser für das Reiten eines Pferdes sein. Ich denke da, sind wir uns alle einig – daher beanspruchen eigentlich ja auch alle Reitlehren für sich, die jeweiligen Theorien und Verfahrensweisen am Vorbild der Natur ausgerichtet zu haben. – das grasende Pferd ist DAS Vorbild für eine der wichtigsten heute proklamierten Trainingsmethoden „dem Vorwärts-Abwärts-Reiten“ des Pferdes. Im Zusammenhang mit der Erklärung zu den Vorteilen des Vorwärts-Abwärts hören wird vor allem die Wichtigkeit und Funktion des Nackenrückenbandes herangeführt.

Man liest und hört meist folgende Aussagen: “Das Nackenrückenband trägt das Gewicht” – und “Das Nackenrückenband wölbt den Rücken auf” oder “Das Nackenrückenband hebt den Rücken an” Wichtige Herleitung ist in der Tat die Betrachtung des grasenden Pferdes in der Natur. Durch den gesenkten Hals beim Fressen wird das Nackenband gespannt und zieht über den Widerrist hinweg den Rücken im Bereich der Sattellage nach oben. Aber gilt das auch für das gerittene Pferd?
Lokalisierung und Konstruktion des Nackenrückenbandes

Das Nackenrückenband ist eine für das Pferd enorm wichtige Konstruktion, denn die Natur hat dem Pferd damit eine effiziente Energiesparkonstruktion spendiert. Das Nackenrückenband besteht aus 2 Teilen: Dem Nackenstrang, einem sehnigen Band (Funiculus nuchae) und der Nackenplatte (Lamina nuchae). Der Nackenstrang (Funiculus nuchae) ist das stärkste und längste Band im Pferdekörper. Dieser sehnige Strang setzt am Hinterhaupt an und verläuft über die Nackenplatte hinweg zu den Brustwirbeln des Widerristes (genauer gesagt setzt es am Dornfortsatz (Processus spinosus) des 3. – 4.en Brustwirbels an und bildet dort die Widerristkappe. Von dort aus verläuft es über die gesamte Brustwirbelsäule hinweg bis hin zum Kreuzbein. Diesen Teil des Nackenbandes nennt man auch Rückenband (Ligamentum supraspinale). Konkret kann man sagen, dass der Verlauf des Nackenstrangs das beschreibt, was wir Reiter als die “Oberlinie des Pferdes” bezeichnen. Die Nackenplatte (Lamina nuchae) ist eine Konstruktion aus paarigen Elementen, die wie ein Fächer von den Halswirbeln 2. bis 7. (C2 bis C5) ausgehend zum kaudalen Drittel des Nackenbandes verläuft.
Achtung: In einigen der Darstellungen hier, sowie in vielen älteren Lehrbüchern sind Verbindungen der Nackenplatte zu C6 und C7 zu sehen Während Urpferde und Zebras diese noch besitzen, ist diese Verbindung bei unseren heutigen domestizierten Pferden nicht mehr existent. Es ermöglicht den Pferden eine höhere Flexibilität im unteren Bereich der Halswirbelsäule bei leider auch vorherrschender Instabilität


Funktion des Nackenrückenband

Kommen wir zur Funktion des Nackenrückenbandes für das ungerittene Pferd in der Natur. Wie bereits eingangs erwähnt, dient das Nackenrückenband dem Pferd vor allem dabei, Energie und Muskelkraft zu sparen. Es ermöglicht dem Pferd zum Beispiel, das Tragen des Kopfes in waagerechter Position, ohne dabei viel Muskelkraft aufzuwenden. Die Nackenplatte, mit ihrer “Anbringung” an insgesamt 4 der 7 Halswirbel, ermöglicht diese kraftsparende Aufhängung des Kopfes und der Halswirbelsäule. So ein Pferdekopf wiegt schnell mal ca. 30kg und dazu kommt das Gewicht der Halswirbelsäule mit dem dazugehörigen nicht zu verachtenden Gewicht der Muskeln. Kopf und Hals des Pferdes nehmen übrigens bereits etwa ein Drittel des Körpergewichtes ein und sind damit verhältnismäßig schwer.

Die gesamte Konstruktion erinnert auch an einen Lastenkran. Übrigens unterstützt die elastische Energie die in der Nackenplatte gespeichert ist, über 50% der Bewegung des Kopfes im Schritt, und über 30% im Trab und im Galopp. Das bedeutet leider auch, stört die Reiterhand durch Festhalten oder gar „Festsetzen“ dieser Bewegungsfreiheit den Kopf und Hals des Pferdes, dann müssen die Muskeln die Arbeit „gegen“ die Hand übernehmen. Wir alle kennen auch den Ausspruch „Druck erzeugt Gegendruck“ – dieser hat auch für die Kopf-Hals-Achse Anspruch auf Richtigkeit. Die zweite wichtige Funktion des Nackenbandes, ist die Unterstützung beim Tragen des Gewichts des Brustkorbs. Dieser Brustkorb mit den inneren Organen hat ein Gesamtgewicht von ca. 250 – 300kg. Da das Pferd in der Natur normalerweise etwa 18-20 Stunden am Tag mit Nahrungsaufnahme beschäftigt ist, und somit die Kopf-Hals-Achse tief trägt, hilft das Nackenband dabei die Muskulatur der Brustwirbelsäule zu entlasten.
Was passiert nun, wenn das Pferd den Kopf und Hals nach unten senkt?

Dehnt das Pferd den Hals nach vorne unten, übt das Nackenband eine entsprechende Zugwirkung auf die vorderen Wirbel der Brustwirbelsäule aus. Dabei werden die Dornfortsätze des Widerristes aufgerichtet und gleichzeitig wird die Zugwirkung auf das sehnige Rückenband, das als direkte Fortsetzung des Nackenstrangs an den Dornfortsätzen der Brustwirbelsäule befestigt ist, auf den Rücken übertragen. Je nach Pferdetyp, Alter etc. wird die Oberlinie dabei leicht angehoben. Das Anheben der Rückenpartie ist dabei zweitrangig – wichtiger ist für das Pferd in der Natur die “Aufhängung” der Brustwirbelsäule entlang dem gespannten Band. Die Konstruktion profitiert dabei von dem besonderen Verlauf der Brustwirbelsäule. Die Konstruktion der “oberen Verspannung” funktioniert ähnlich dem Prinzip von Umlenkrollen oder auch Zahnrädern. Vor allem der Widerrist mit seinen langen Dornfortsätzen und die Kruppe können den Zug des Nackenbandes entsprechend “Umlenken” und die Kraft des jeweiligen Hebels so bestmöglich übertragen. Deshalb sind auch die ersten 9 Brustwirbel merklich länger und in Normalposition schweifwärts gerichtet als die folgenden Wirbel. Senkt das Pferd den Kopf zum Grasen, dann ist übrigens die gesamte Konstruktion des Nackenrückenbandes bereits in einer maximalen Dehnung. Durch den enormen Hebel des Halses und der entstehenden Zugkraft, richten sich die vorderen Brustwirbel des Widerrists nach vorne und gleichzeitig senkt sich der Widerrist zwischen den Schultern, da das Pferd kein Schlüsselbein hat und der Brustkorb nur muskulär zwischen den Schultern aufgehangen ist. Dabei gilt es allerdings zu beachten, dass wir hier ein stehendes oder maximal im langsamen Schritt gehendes Pferd betrachten und das Absenken des Widerrists für das ungerittene Pferd keinen Nachteil hat, da die Stoßdämpfer Funktion des Schultergürtels nicht zum Tragen kommen muss.
Fazit zur Funktion des Nackenrückenbandes beim ungerittenen Pferd:
Wir können festhalten – Aus Sicht der Natur ist das Senken des Kopfes und die entlastende Funktion des Nackenrückenbandes also eine wunderbare Sache. Was aber nun wenn wir einen Reiter auf das Pferd setzen? und darüber hinaus auch noch das Pferd in der Bewegung betrachten?
Anatomie und Biomechanik des Nackenrückenbandes beim gerittenen Pferd

Einen der wichtigsten anatomischen Fakten über das Pferd und einer der maßgeblichen Unterschiede zum Menschen ist, dass das Pferd kein Schlüsselbein hat. Der Brustkorb des Pferdes ist zwischen den Schulterblättern durch den sogenannten Schultergürtel rein über Bindegewebe und Muskulatur aufgehangen. Diese Konstruktion ist absolut genial, denn sie fungiert als Stoßdämpfer für die Vorhand des Pferdes und schont in der Bewegung, vor allem im Trab, Galopp und bei Sprüngen die Sehnen und Bänder der Vorderbeine. Diese Konstruktion ermöglicht es der Wirbelsäule, sich in den Schultern zu heben und zu senken. Das Schulterblatt kann entlang des Brustkorbes nach vorne und nach hinten rotieren und dazu auf und ab- “gleiten”. Kommen wir also kurz nochmal zurück zu unserem grasenden Pferd – auf dem wir zunächst mal gedanklich NOCH keinen Reiter platzieren. Wir haben gesehen, dass wenn das Pferd den Kopf und Hals nach unten senkt, das Nackenrückenband in eine maximale Dehnung gebracht wird und der Zug an den Dornfortsätzen des Widerrists diese nach vorne zieht.
Das Absenken des Widerrists
Nun ist wie gesagt dieser Widerrist nicht fest mit den Schultern verbunden – das Pferd hat kein Schlüsselbein. Das führt dazu, dass wenn das Pferd den Kopf und Hals senkt, gleichzeitig der Widerrist des Pferdes ebenfalls nach unten gezogen wird und das nicht unbeträchtlich – bei einem Pferd mit einer Widerristhöhe von 168 cm sind das ohne Reiter um die 2cm. Wie zuvor bereits erwähnt: Die zuvor beschriebene Zugkraft des Nackenbandes lässt die Brustwirbel nach vorne “kippen”. Betrachtet man zum Beispiel die Dornfortsatzkappe des 5ten Brustwirbels, so bewegt sich dieser innerhalb der Schulterstruktur oftmals mehr als 20 Zentimeter nach vorn unten. Es dürfte klar sein, dass wir es nun NICHT mehr mit einem Stoßdämpfer zu tun haben, sondern die Konstruktion relativ starr wird. Das ist auch kein Problem für ein grasendes Pferd ohne Reiter. Denn so ein grasendes Pferd steht ja in erster Linie auf der Wiese und läuft maximal einen Schritt zum nächsten Grasbüschel und damit ist die Funktion eines Stoßdämpfers auch nicht so wichtig. Wir haben ja zuvor von der Umlenkrollenfunktion des Widerrists gesprochen – nun wird deutlich, dass diese vordere Umlenkrolle nicht fest verankert ist, sondern sich mit Absenken des Halses nach vorne unten “verabschiedet”. Ein Fakt, der übrigens auf vielen anatomischen Zeichnungen und Darstellungen nicht berücksichtigt wird. Wohlgemerkt wir betrachten immer noch das Pferd im Stand – ohne Reiter und vor allem nicht in der Bewegung. Das Absinken des Widerrists wird insgesamt sowohl in Büchern zur Anatomie, als auch zur Reitlehre sehr wenig betrachtet. Der leider verstorbene französische Reitmeister Jean-Claude Racinet hat vielfach in seinen Publikationen auf diese Problematik hingewiesen und an einem einfachen Experiment erklärt, wie jeder selbst diese Problematik nachvollziehen kann.

Dieses Experiment sieht wie folgt aus: Man stellt ein Pferd auf einen ebenen Boden und bringt den Kopf in eine normale Position, so wie das Pferd auch in der Natur stehen würde, wenn es nicht grast, aber auch nicht besonders aufgeregt ist. Dann misst man die Höhe des Widerrists. Anschließend bringt man das Pferd dazu, den Kopf maximal zu senken, und misst den Widerrist erneut. Zu guter Letzt bringt man das Pferd in Aufrichtung – allerdings bei offenem Genick und misst den Widerrist auch für diese Position. Die gleiche Versuchsreihe wird anschließend noch mit einem Reiter durchgeführt und ebenfalls in allen drei Positionen wird die Widerristhöhe ermittelt. Das Ergebnis ist verblüffend, denn es stellt einige Theorien auf den Kopf. Denn während die hohe Halsposition in beiden Fällen einen eher positiven Effekt ausmacht und sich der Widerrist anhebt, sinkt der Widerists hingegen bei tiefer Halsposition um bis zu 4cm (Mittlerweile gab es übrigens zum Anheben und Absenken des Widerrists auch eine seriöse Studie an der Unversität von Götingen. Dabei wurde eine Vielzahl von Pferden mit Hilfe von sehr exakt arbeitenden Lasergeräten vermessen. Die Studie belegt das Experiment von Jean-Claude Racinet noch einmal eindeutig) MOMENT…
Was war jetzt mit dem Anheben des Rückens im Bereich der Sattellage?
Jetzt werden sich einige natürlich fragen – moment… es ging ja um das Anheben der Oberlinie, vor allem in der Sattellage durch das Nackenband. Schließlich haben wir ja gesehen, dass zwar der Widerrist sinkt – aber die Vermutung liegt ja nahe, dass die Brustwirbelsäule trotz alledem durch die tiefe Halsposition begünstigt wird. Schauen wir uns dazu ein interessantes Video von Science in Motion an:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenIm Video sehen wir zunächst den Beweis für das Anheben der Brustwirbelsäule durch das Absenken der Halswirbelsäule. Allerdings galt dies nur für ein Pferd ohne Reitergewicht. Später im Video wird gezeigt, was passiert, sobald einer der Helfer eine Hand in die Sattellage legt. Was zu sehen ist, ist dass durch die nur leichte Krafteinwirkung auf das Rückenband die Aufwölbung der Oberlinie nicht mehr erfolgt und der Person die die Halswirbelsäule absenken möchte, die Halswirbelsäule auf dem Tisch entgleitet. Der Versuchsaufbau ist hier zwar etwas unglücklich, denn der Tisch stellt eine fixierte vordere Brustwirbelsäule dar. Wir haben aber vorher bereits gelernt, dass die muskuläre Aufhängung des Brustkorbs ein Absenken des Widerrists zulässt. Durch den Druck, der auf den Tisch ausgeübt wird, gleitet die Wirbelsäule auf dem Tisch weg. Der Versuch verdeutlicht somit, dass durch das Gewicht in der Sattellage der Widerrist noch einmal stärker absenken wird.
Was macht nun das Wegdrücken des Rückens aus?
Setzen wir uns als Reiter auf ein Pferd, tendiert der lange Rückenmuskel dazu zu kontrahieren, er zieht sich zusammen.

Dieses Zusammenziehen können wir recht deutlich sehen – unseriöse “Einrenker“ machen sich das leider auch gerne zu nutzen – in dem sie in die Muskulatur der Sattellage greifen – denn nahezu jedes Pferd drückt dann optisch den Rücken weg, weil halt durch den Griff in die Muskulatur der lange Rückenmuskel kontrahiert. Das verursacht schnell eine Kettenreaktion – je nachdem ob hier wirklich Probleme vorliegen – also Schmerzen entstehen oder durch das Pferd sich einfach nur etwas über das unkontrollierte Zusammenziehen erschrickt. Der Muskel hat auch einen Halsteil und deshalb ziehen auch einige Pferde den Hals gleichzeitig hoch. Ein 2ter Aspekt ist das Strecken des Lumbosakralgelenks durch die Kontraktion der Strecker der Wirbelsäule (Der lange Rückenmuskel fungiert z.B. als Strecker) Dieser Aspekt verstärkt sich vor allem, wenn das Pferd vermehrt nach hinten heraus tritt und die Schubkraft die Bewegung dominiert.
Bedeutung der Bauchmuskeln für das Aufwölben des Rückens
Leider wird in der Diskussion über den Rücken viel zu viel über Nackenband und Rückenmuskulatur gesprochen und zu wenig über die Bauchmuskulatur. Dabei ist diese enorm wichtig. Wir sprechen hier von 4 Bauchmuskeln – die paarig angeordnet sind – also vier auf jeder Seite des Pferdes – insgesamt 8 Muskeln.

Die Bauchmuskeln sind vor allem wichtig als Eingeweideträger und agieren quasi als Antagonist zur Rückenmuskulatur. Daher können sie auch nur arbeiten, wenn die Rückenmuskulatur entspannt und dehnfähig ist. Bei Verspannung im Rücken zum Beispiel durch das Reitergewicht oder schlecht passende Sättel kann die Brustmuskulatur nicht richtig arbeiten. Die Muskelpartien behindern sich dann quasi gegenseitig. Auch der Einfluß des Kiefergelenks sollte nicht unterschätzt werden (z.B. in Folge zu fest verschnallter Nasen- und Sperriemen). Ein verspannter Kiefer kann sogar beide Muskelgruppen negativ beeinflussen bzw. umgekehrt zur Verspannung des Kiefers führen. Arbeiten die Muskeln korrekt, unterstützen sie zum einen das Vorschwingen der Hinterbeine, zum anderen aber wölben sie auch die Rückenpartie auf und entlasten die Rückenmuskulatur und die Nackenrückenbandkonstruktion. Der erste Muskel dieser dafür wichtigen Muskeln ist der gerade Bauchmuskel (rectus abdominis). Dieser Muskel zieht sich unter dem gesamten Brustkorb vom Brustbein bis zum Hüftgelenk. Spannt das Pferd diesen an – dann zieht er den unteren Rand des Beckens nach vorn, es kommt zur Öffnung der Gelenke im Bereich der Lendenwirbelsäule und des Kreuzbeins und der Vorgriff des jeweiligen Hinterbeins wird ermöglicht. Die Brustwirbelsäule wölbt sich ebenfalls auf. Jeder kennt auch die Tests, bei denen man mit dem Finger oder zum Beispiel einem sogenannten Deuserstäbchen den geraden Brustmuskel reizt und testet ob das Pferd die Brustwirbelsäule aufwölben kann. Der zweite Muskel ist der äußere schräge Bauchmuskel – der Obliqus abdominis externus. Dieser Muskel verläuft von den Rippen bis zum Hüfthöcker und setzt dabei auch an der Innenseite des Oberschenkels an. Er ist ebenfalls an der Bewegung der Hinterbeine beteiligt, vor allem im Galopp – beim Vorschwingen des Hinterbeins. Der dritte Muskel im Bunde ist der innere schräge Bauchmuskel der obliqus abdomins internus . Er ist nicht so sehr an der Bewegung beteiligt. Er verläuft vom Hüfthöcker, der Darmbeinfaszie zur letzten Rippe des Brustkorbs und zur Innenfläche der letzten 3 Rippenknorpel. Er dient vor allem zur Aufhängung des Brustkorbs am Hüfthöcker unterstützt aber auch die Atmung und das Herauspressen des Kots. Der vierte Bauchmuskel ist der querverlaufende Bauchmuskel der transverus abdomins – dieser hat ebenfalls keine Bewegungsfunktion, sondern vor dient vor allem als Hängeaufrichtung für den Bauch.
Ist Dehnungshaltung im vorwärts nun gänzlich schlecht?
Die Dehnungshaltung hat aus physiotherapeutischer Sicht in manchen Fällen durchaus seine Berechtigung – denn folgende Vorteile kann man dem Vorwärts-Abwärts zusprechen:
- Entlastung der Hinterhand – durch Verlagerung des Schwerpunkts nach vorne
- Durch die vermehrte Belastung der Vorhand kommt es zu einer Steigerung der Muskelaktivität der Muskelgurte (Aufhängung des Rumpfes).
- Bauchmuskulatur und Serratus Muskulatur sorgen bei anschließender Aufrichtung wieder für bessere Entlastung in natürlicher Aufrichtung.
- Schmerzlinderung bei Verspannungen im Kopf-hals-Widerristbereich
- Dehnung und Streckung der Strukturen oberhalb der Wirbelachse – Steigerung der Aktivität der Bauchmuskeln
Aus physiotherapeutischer Sicht kann es also durchaus sinnvoll sein „kurze“ Phasen des Vorwärts-Abwärts zu fordern und zu fördern. Am liebsten eher ohne Reiter, oder am Ende einer Reiteinheit. Allerdings müssen wir diese Lektion als ganz gezielt eingesetztes Werkzeug nutzen können… Denn es birgt völlig unterschätzte Gefahren Überstrapazieren des Nackenrückenbands.

Das Beizäumen im Vorwärts Abwärts führt – wie wir auch im Video gesehen haben – zum Kollabieren Unterstützungssfunktion des Nackenbandes direkt hinter dem Hinterhaupt – der Zug bleibt allerdings leider bestehen. Das Gewicht des Reiters birgt eine weitere Sollbruchstelle der Unterstützungsfunktion. Aktivieren wir nun die Hinterhand erhält das Rückenband zusätzlich zum Zug von Vorne auch noch mal Zug von hinten – die maximale Dehnfähigkeit des Nackenrückenbandes wird so an mehreren Stellen überstrapaziert. Die Folge sind relativ schnell Entzündungen an den Schleimbeuteln und langzeitlich kommt es zu Verkalkungen des Nackenrückenbandes Ein einmal entzündeter Schleimbeutel regeneriert nur sehr schlecht.
Nachteile der Dehnung im Vorwärts Abwärts

Trotz der positiven Vorteile der Dehnungshaltung aus physiotherapeutischer Sicht, sollte die Arbeit des Pferdes mit abgesenktem Hals nicht zu häufig wiederholt oder über einen zu langen Zeitraum ausgeführt werden, da die Überlastung der Vorderhand eine erhöhte Belastung von Knochen, Gelenken und Sehnen mit sich bringt. Eine absolute Kontraindikation für diese Übung besteht darüber hinaus bei Pferden mit vorangegangenen Sehnenentzündungen oder Gelenkverletzungen. Hier gilt äußerste Vorsicht bei vermehrter Vorhandlastigkeit und einhergehendem Verlust der Stoßdämpferfunktion der Schulterregion durch das Absenken des Widerrists.
Die Nachteile der Dehnungshaltung im Vorwärts-Abwärts sind:
- Erhöhte Belastung von Knochen, Gelenken und Sehnen.
- Die Stoßdämpfer Funktion des Schultergürtels wird geringer
- Eine Kontraindikation für Pferde mit vorangegangenen Sehnenentzündungen oder Gelenkentzündungen.
- Erhöhte Belastung der Kopf-Hals-Balancierstange. Diese müssen durch die dorsalen Halsmuskeln ausgeglichen werden (isometrische Arbeit=sehr anstrengend).
- Bei gleichzeitiger Beizäumung kommt es zur Überstrapazierung der Nackenrückenbandkostrunktion
Es spricht also, beim Pferd ohne Gelenk und Sehnenproblemen, nichts dagegen ganz gezielt Entspannung durch eine Dehnung zu gegebenem Zeitpunkt und in angemessener Dauer herbeizuführen. Vor allem darf es dabei nicht aber nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Die Nase darf wirklich maximal auf Buggelenkshöhe getragen werden. Noch wichtiger ist, dass das Pferd bei offenem Genick, mit autonom beweglicher Halswirbelsäule bewegt wird – es darf nicht beigezäumt werden. Auf eine Aktivierung der Hinterhand sollte unter allen Umständen “in der Phase der Dehnung” verzichtet werden, um der Überstrapazierung der Nackenrückenband Konstruktion vorzubeugen. Und – das Dehnen muss ein gezielt eingesetztes Werkzeug sein – dessen Einsatz von einer Ursache abhängt – es ist kein Selbstzweck. Trabeinheiten von mehr als 5 Minuten auf der Vorhand sind langzeitlich Gift für Gelenke, Sehnen und Bänder.
Was ist die Alternative zum Lösen im VA und der Dehnungshaltung?

Wer kennt nicht den Ausdruck „Schulterherein ist das Aspirin der Reitkunst“? Die Vorteile des richtigen Schulterherein sind immens:
- Die äußere Seite der Brustwirbelsäule wird gedehnt
- Die Schulter wird entlastet
- der Widerrist angehoben.
- Aufgrund dessen werden die Vordergliedmaßen des Pferdes ebenfalls entlastet.
Wer sein Pferd korrekt in Seitengängen im Schritt löst kann danach „bequem“ aussitzen im Trab. Das Lösen und gymnastizieren in den Seitengängen verschafft dem Pferd das nötige Gleichgewicht und die Tragkraft wird gefördert.
Schulterherein – Weniger Biegung als man denkt und mehr Dehnung als man glaubt
Wir sprechen zwar immer von Biegung des Pferdes – allerdings muss man richtigerweise sagen, dass weniger Biegung im Pferdekörper entsteht als die Optik es vermuten lässt.

Die Biegung findet ihren Ursprung in der Stellung des Genicks – genauer gesagt aus dem Zusammenspiel der Gelenke zwischen Hinterhaupt und erstem Halswirbel und dem Gelenk zwischen erstem und zweiten Halswirbel. Nur wenn diese korrekt arbeiten kann der Rest auch funktionieren. Eine erzwungene Stellung durch Ziehen am inneren Zügel führt bereits zum Scheitern der Biegung. Korrekte Stellung ist der Schlüssel zur Biegung denn Gelenke der Halswirbelsäule bilden den beweglichsten Teil des Pferdekörpers und erzeugen somit den deutlichsten und beweglichsten Teil der Biegung. Durch die Beckenrotation wird die der äußere schräge Bauchmuskel (auf der Seite auf der sich das Pferd biegt) angespannt. Gleichzeitig rotieren die Brustwirbel und damit der Brustkorb. Die innere Hüfte kommt nach vorn und das Pferd wird zu mehr Lastaufnahme animiert. Die äußere Schulter sollte dabei freier werden. Wie wir sehen ist im Bereich der Lendenwirbel nahezu keine Biegung. Der äußere lange Rückenmuskel wird dabei gedehnt. Die Rotation des Brustkorbs ist aber nur möglich, wenn die Muskulatur dies auch zulassen kann. Jegliche Verspannungen können ebenso wie vorhandene Blockaden eine korrekte Rotation der Wirbel verhindern. Übrigens fördert das Schulterherein auch die Lockerheit im Kiefer, denn die entspannende Wirkung des Schulterherein äussert sich fast immer in einem Nachgeben des Kiefergelenks.
Anders falsch ist aber nicht gleich besser
Aber vorsicht! Auch das Arbeiten in den Seitengängen hat seine Vor- und seine Nachteile. Denn natürlich ist die Arbeit in der tragkraftdominierten Bewegung wesentlich kräftezehrender und muss daher langsam an das Pferd herangeführt werden. Es empfiehlt sich zu Beginn wirklich nur kurze Einheiten durchzuführen und langsam zu steigern, denn es handelt sich wirklich um Krafttraining. Selbstverständlich darf auch kein zu hohes Tempo zu Beginn abverlangt werden, es ist absolut erforderlich die Seitengänge zunächst im Schritt zu etablieren und erst dann in den Trab einzubauen, wenn diese im Schritt ohne Probleme funktionieren. Gerade bei den Seitengängen ist es ratsam lieber 2-3 gute Schritte durchzuführen, als 20 schlechte. Der Mehrwert der Seitengänge verliert sich absolut in der unsachgemäßen Ausübung. Ein Vorbeitreten am Schwerpunkt, festmachen im Rücken oder Verwerfen im Genick sind einige Faktoren, die das Schulterherein wertlos macht – daher sollten vor allem unerfahrene Reiter sich nicht ohne erfahrenen Ausbilder auf den Weg machen. Anders falsch ist nämlich NICHT besser. Dies gilt genauso für das Reiten in Dehnungshaltung – die richtige Ausführung, Dauer der Anwendung und vor allem Erreichen des Werts einer Lektion wird leider immer noch viel zu häufig unterschätzt und geht zu Kosten der Pferdegesundheit. Dann kommt der Ausspruch “Die Dosis macht das Gift” zum Tragen.

Das inflationäre Reiten in nicht erforderlicher Dehnungshaltung über viele Minuten hinweg ruiniert die Pferde mittel- bis langfristig. Eine gänzliche Ablehnung der Dehnung zu Gunsten falsch ausgeführter Seitengänge macht das Leben der Pferde aber auch nicht einfacher. Am Ende muss man sich sinnvoll mit der aktuellen Situation des Pferdes auseinandersetzen und entscheiden, welche Lektion “in diesem Moment” richtig und förderlich für das Pferd ist. Das Abspulen von stereotyp ausgeführten Lektionen ist kein pferdegerechtes Reiten. hinzugezogene Quellen:
- Feines Reiten – Jean Claude Racinet – erschienen im Olms Verlag
- Physiotherapie für Pferde – Jean M. Denoix
- ABC of the horse – Pauli Grönberg
- Osteopathie für Pferde – erschienen im Enke Verlag
- Osteopathie beim Pferd – erschienen im Enke Verlag
- Pferde gesund Reiten – Robert Stodulka – erschienen im Kosmos Verlag
- Science of motion


Diese Beiträge könnten dir ebenfalls gefallen:
Gallen beim Pferd – Schönheitsfehler oder ernstzunehmendes Warnsignal?
Gallen beim Pferd sind Schwellungen an Gelenken, Sehnenscheiden oder Schleimbeuteln – oft harmlos, manchmal jedoch [...]
weiterlesenDas Märchen vom ausgerenkten Wirbel beim Pferd
Warum „Einrenken“ beim Pferd ein überholter Mythos ist – denn wo nichts ausgerenkt sein kann [...]
weiterlesenISG – Das Iliosakralgelenk beim Pferd verstehen
Mythos ISG beim Pferd! – “Dein Pferd hat eine Blockade im Iliosakralgelenk – das ISG muss [...]
weiterlesenWoher kommt die Idee des gespannten Zügels?
Ein nicht gespannter Zügel wird heutzutage oft als “fehlende Anlehnung” kritisiert. Wenn man sich mit [...]
weiterlesenRange of Motion bei Pferden – Warum die Ausnutzung von Gelenkwinkeln wichtig sind
Was bedeutet „Range of Motion“ (ROM)?ROM bezeichnet die Bewegungsamplitude, also den Bewegungs- bzw. Gelenkwinkelbereich, den [...]
weiterlesenPferde gesund bewegen als „Top Dienstleister 2025“ ausgezeichnet – über 600 positive Kundenstimmen
Münsterland, September 2025. Die Online-Lernplattform Pferde gesund bewegen wurde auch 2025 von Proven Expert gleich [...]
weiterlesenTrapezmuskel beim Pferd – Funktion, Probleme und Trainingstipps
Der Trapezmuskel beim Pferd (Musculus trapezius) gehört zu den wichtigsten Muskeln im Schulterbereich. Er beeinflusst [...]
weiterlesenRumpfheber beim Pferd – Funktion, Anatomie und Bedeutung für den Schultergürtel
Eine der zentralen anatomischen Besonderheiten des Pferdes und zugleich ein wesentlicher Unterschied zum Menschen ist [...]
weiterlesen