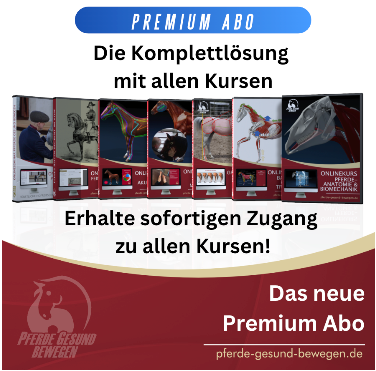Allgemein
Gallen beim Pferd – Schönheitsfehler oder ernstzunehmendes Warnsignal?
Gallen beim Pferd sind Schwellungen an Gelenken, Sehnenscheiden oder Schleimbeuteln – oft harmlos, manchmal jedoch Warnsignale für Überlastung oder Entzündung. Erfahre, wie Gallen entstehen, woran du gefährliche Formen erkennst und welche Behandlung wirklich hilft, damit dein Pferd dauerhaft gesund und beweglich bleibt.
Gallen zählen zu den häufigsten Auffälligkeiten am Bewegungsapparat des Pferdes. Wenn Reiter oder Pferdebesitzer von „Gallen“ sprechen, meinen sie nicht die Gallenblase des Verdauungssystems (das Pferd hat keine Gallenblase), sondern eine Schwellung im Bereich von Gelenken, oder Schleimbeuteln. Die veterinärmedizinische Begriffe Gallen, Hygrom oder Hydrops beschreiben eine Umfangsvermehrung bzw. Verdickungen dieser Strukturen, die meist durch eine vermehrte Ansammlung von Synovialflüssigkeit* oder eine Verdickung der Membranen entsteht. In den allermeisten Fällen handelt es sich um Schönheitsfehler. Durchaus können sie jedoch auch Hinweis auf ernsthafte Probleme im Gelenkstoffwechsel sein.
*Die Synovialflüssigkeit ist die „Gelenkschmiere“ des Pferdes – eine klare, zähflüssige Substanz, die in jedem Gelenk vorkommt. Sie sorgt dafür, dass sich die Gelenkflächen reibungslos bewegen können, versorgt den Knorpel mit Nährstoffen und wirkt wie ein Stoßdämpfer bei Belastung.

Wie Gallen entstehen
Die Gelenke des Pferdes sind auf eine feine Balance angewiesen. Die Synovialflüssigkeit, die das Gelenk schmiert und ernährt, wird in einem ständigen Kreislauf gebildet und wieder abgebaut. Kommt dieses Gleichgewicht ins Wanken, sammelt sich Flüssigkeit an und führt zu einer sichtbaren Schwellung. Auslöser hierfür sind vielfältig. Häufig entstehen Gallen durch chronische Reize: Übermäßige Belastung auf hartem Boden, zu intensives Training oder kleine Mikrotraumen in der Gelenkkapsel sorgen dafür, dass das Gelenk stärker durchblutet und vermehrt Flüssigkeit produziert. Auch Gelenkdefekte wie Knorpelverletzungen oder kleine freie Gelenkkörper – sogenannte „Chips“ – können permanenten Druck ausüben und damit den Reiz unterhalten.
Zu den möglichen Ursachen für Gallen beim Pferd zählen:
- Fehlstellungen von Giedmaßen und Hufen
- Muskelverspannungen, Triggerpunkte
- schwaches Bindegewebe – Probleme der Faszien
- Stoffwechselstörungen
- Bewegungsmangel
- Reaktionen nach Infektionen
- zu frühes Einreiten und Belasten von jungen Pferden
- unzureichender Abtransport von Stoffwechselprodukten z.B. nach Operationen
- Tritt durch andere Pferde
Nicht zu unterschätzen sind zudem biomechanische Faktoren. Pferde mit Fehlstellungen, ungleichmäßigem Hufwachstum oder asymmetrischer Muskulatur belasten ihre Gliedmaßen nicht gleichmäßig. Die resultierenden Druckspitzen wirken dauerhaft auf bestimmte Gelenke und Sehnenscheiden ein und fördern dort die Bildung von Gallen. Ein weiterer Risikofaktor ist Bewegungsmangel. Pferde, die stundenlang in engen Boxen stehen, haben weniger natürliche Gelenkbewegung und damit eine schlechtere Zirkulation der Synovialflüssigkeit. Auch äußere Faktoren wie schlecht sitzende Gamaschen oder wiederholte Stöße an die Boxenwand können zu lokalen Reizzuständen führen.
Wann Gallen harmlos sind – und wann nicht
Viele Pferde zeigen Gallen, ohne jemals auffällig zu lahmen oder Einschränkungen im Training zu haben. Diese weichen, verschieblichen Schwellungen sind oftmals nicht schmerzhaft und werden deshalb in der Praxis als kosmetisch eingestuft. Tierärzte sprechen dann von „Schönheitsfehlern“. Dennoch sollte man sich bewusst machen: Jede Galle ist das Resultat eines Reizes. Ob dieser Reiz einmalig war oder ob ein chronisches Problem zugrunde liegt, lässt sich nicht auf den ersten Blick beurteilen.
Gefährlich können Gallen vor allem dann werden, wenn sie hart, warm oder druckempfindlich sind. In solchen Fällen besteht der Verdacht auf eine aktive Entzündung. Das Pferd kann Unlust in der Bewegung zeigen, kurze Tritte machen oder sogar lahmen. Besonders problematisch sind Gallen, die im Zusammenhang mit Arthrose oder anderen degenerativen Gelenkerkrankungen auftreten. Dann sind sie nicht nur Symptom, sondern auch Teil eines fortschreitenden Krankheitsprozesses.
Zwar seien viele Fälle harmlos, doch gerade im Sportpferdebereich können Gallen Hinweise auf Überlastung oder beginnende Gelenkerkrankungen sein. Eine genaue Beobachtung und gegebenenfalls weiterführende Diagnostik sind daher ratsam.
Diagnostik und Abklärung
Die Untersuchung beginnt in der Regel mit dem Abtasten der betroffenen Region. Der Tierarzt achtet auf Konsistenz, Wärme und Schmerzreaktionen. Gleichzeitig werden beide Gliedmaßen verglichen, um Unterschiede im Umfang oder in der Belastung festzustellen. Eine Ganganalyse kann zeigen, ob die Schwellung bereits Einfluss auf den Bewegungsablauf nimmt.
Wenn ein Pferd lahmt oder die Galle auffällig verhärtet ist, kommen bildgebende Verfahren zum Einsatz. Ultraschalluntersuchungen eignen sich hervorragend, um Sehnenscheiden und Gelenkkapseln darzustellen. Röntgenbilder zeigen, ob knöcherne Veränderungen, Chips oder Knorpelschäden vorliegen. In speziellen Fällen wird eine Gelenkflüssigkeitspunktion durchgeführt, um Hinweise auf eine Entzündung zu erhalten. Große Kliniken setzen bei Bedarf auch Arthroskopien ein, bei denen das Gelenk endoskopisch untersucht und gleichzeitig therapiert werden kann.
Behandlungsmöglichkeiten
Die Therapie von Gallen richtet sich, wie auch bei der Bursitis des Menschen, nach ihrer Ursache. Weiche, nicht schmerzhafte Gallen ohne weitere Symptome benötigen häufig keine direkte Behandlung, sollten aber regelmäßig kontrolliert werden. Zeigt das Pferd jedoch Schmerzen oder eine Bewegungseinschränkung, muss gehandelt werden.
Während bei aseptischen Formen meist Ruhe, lokale Kühlung und Entzündungshemmung genügen, erfordern infektiöse Prozesse eine gezielte tierärztliche Behandlung, gegebenenfalls inklusive Punktion oder antibiotischer Therapie.
In der Akutphase kommen oft entzündungshemmende Maßnahmen wie Kältebehandlungen oder die Gabe von nichtsteroidalen Antiphlogistika zum Einsatz. Durch sofortige Therapiemaßnahmen kann der Entzündungsherd schnell bekämpft. Auch eine zeitweise Reduktion des Trainings kann sinnvoll sein, um das Gelenk zu entlasten. Physiotherapeutische Maßnahmen – etwa sanfte Mobilisation, Dehnungen oder gezielte Übungen – unterstützen die Regeneration. In manchen Fällen helfen Kompressionsbandagen, die Schwellung zu reduzieren.
Eine Injektion in die Galle birgt aber immer das Risiko einer Infektion der betroffenen Strukturen – ohne die Garantie für einen Behzandlungserfolg. Man sollte also immer abwägen, ob eine derartige Behandlung wirklich nötig ist.
Wenn strukturelle Schäden wie Chips oder knöcherne Veränderungen die Ursache sind, bleibt häufig nur ein chirurgischer Eingriff. Arthroskopische Operationen ermöglichen die Entfernung störender Partikel und gelten als Standardverfahren in modernen Pferdekliniken.
Viele Pferde zeigen Gebäudfeauffälligkeiten, Fehlstellungen, sowie gestörte Haltungs- und Bewegungsmuster. Hier gilt es sowohl physiotherapeutisch entgegenzuarbeiten und die Pferde in der Bewegung zu therapieren um mittel- bis langfristig Fehlbelastungen zu korrigieren.
weitere Möglichkeiten zur Behandlung:
- Akupunktur / Akupressur
- Kneippgüsse / Wassertherapie
- Angussverband mit Arnika oder Essigsäure
- Blutegeltherapie
- Ätherische Öle
- Kältetherapie/Kryotherapie
- Lymphdrainage
- Taping
Unabhängig von der gewählten Therapie ist die Nachsorge entscheidend. Dazu gehören ein kontrollierter Belastungsaufbau, die Anpassung der Haltungsbedingungen sowie eine sorgfältige Beobachtung auf erneutes Auftreten.

Wo können Gallen entstehen?
Gallen können an verschiedenen Stellen der Pferdebeine auftreten, je nachdem, welche Gelenke, Sehnenscheiden oder Schleimbeutel betroffen sind. Besonders häufig zeigen sie sich im Bereich der Fessel-, Sprung- und Ellbogengelenke, aber auch am Genick oder an der Vorderfußwurzel können sie entstehen.
Eine der bekanntesten Formen ist die Piephacke – eine Schwellung des Hautschleimbeutels am Fersenbein beziehungsweise im Bereich der Fersenhöcker. Sie kann sich weich und flüssigkeitsgefüllt anfühlen, wenn sich Schleimbeutel- oder Blutflüssigkeit angesammelt hat, oder fester, wenn überwiegend Bindegewebe beteiligt ist. Ihre Form variiert zwischen rund und länglich-oval. Seitlich neben dem Fersenbeinhöcker, also im Bereich des Sprunggelenks, tritt die Eiergalle auf. Diese kann sich bis zur darüberliegenden Achillessehne ausdehnen und dort eine sichtbare Vorwölbung verursachen.
Auch im oberen Bereich des Pferdebeins kommen Gallen vor. Die Stollbeule – auch Liegebeule genannt – zeigt sich als deutliche Umfangsvermehrung am Ellenbogenhöcker. Sie entsteht durch eine Schwellung des dort liegenden Hautschleimbeutels und kann mitunter die Größe eines Tennisballs erreichen. Eine ähnliche Form ist der sogenannte Knieschwamm, bei dem der Hautschleimbeutel im vorderen Bereich der Vorderfußwurzel anschwillt.
Weniger bekannt, aber klinisch bedeutsam ist die Genickbeule, medizinisch als Bursitis nuchalis bezeichnet. Dabei entzündet sich der Schleimbeutel, der auf dem ersten und zweiten Halswirbel liegt und über den der Nackenstrang verläuft. Diese Struktur verbindet Nacken- und Rückenwirbel miteinander und spielt eine zentrale Rolle in der Aufrichtung und Haltung des Pferdes. Im Anfangsstadium fühlt sich die Schwellung warm an und ist schmerzhaft, in fortgeschrittenen Fällen können sich sogar Abszesse bilden. Betroffene Pferde versuchen den Schmerz zu vermeiden, indem sie den Kopf tief halten und die Beweglichkeit im Genick einschränken.
Im Bereich der Hinterbeine treten häufig Kurbengallen auf, die seitlich am Sprunggelenk als deutliche Vorwölbungen sichtbar sind. Auch Kreuzgallen oder Sprunggelenksbeulen gehören zu den typischen Erscheinungsformen in dieser Region. Bei der bekannten Windgalle ist hingegen die Fesselbeugensehnenscheide betroffen – eine Struktur, die häufig durch chronische Belastung oder mangelnde Elastizität des Bindegewebes reagiert.
Medizinisch unterscheidet man Gallen nach der betroffenen synovialen Struktur in Gelenkgallen, Sehnenscheidengallen (Tendovaginitis) und Schleimbeutelgallen (Bursitis). Für bestimmte, häufig betroffene Regionen haben sich zudem eigene Bezeichnungen etabliert, die auch in der Praxis gebräuchlich sind:
- Eiergalle: Anschwellung des Schleimbeutels am Fersenbeinhöcker (Bursa subtendinea calcanea)
- Genickbeule (Talpa): Anschwellung des Schleimbeutels zwischen Nackenband und Atlas (Bursa subligamentosa nuchalis cranialis). Bei chronischem Verlauf kann es zu einer Verkalkung des Nackenbandes kommen.
- Knieschwamm: Anschwellung des Hautschleimbeutels vorn an der Vorderfußwurzel (Bursa subcutanea precarpalis)
- Kreuzgalle: Schwellung des Sprunggelenks durch Reizung der Gelenkkapsel
- Kurbengalle: Anschwellung der gemeinsamen Sehnenscheide von Musculus flexor digitorum lateralis und Musculus tibialis caudalis
- Liegebeule (Stollbeule): Schwellung des Schleimbeutels unterhalb des Ansatzes des Musculus biceps femoris am seitlichen Oberschenkelknochen (Bursa subtendinea musculi bicipitis femoris)
- Piephacke: Schwellung des Hautschleimbeutels am Fersenbein (Bursa subcutanea calcanea)
- Sprunggelenkbeugesehnengalle: Anschwellung der Sehnenscheide des Musculus tibialis cranialis
- Stollbeule: Schwellung des Hautschleimbeutels am Ellenbogenhöcker (Bursa subcutanea olecrani)
Prävention – das beste Mittel gegen Gallen
Damit Gallen gar nicht erst entstehen, sind vorbeugende Maßnahmen entscheidend. Pferde profitieren von einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Belastung und Erholung. Ein abwechslungsreiches Training, das nicht nur monoton auf hartem Boden stattfindet, stärkt den Bewegungsapparat nachhaltig. Regelmäßiger Auslauf sorgt dafür, dass Gelenke in Bewegung bleiben und die Synovialflüssigkeit optimal zirkuliert.
Ebenso wichtig sind korrekt angepasste Hufe und Equipment zum Reiten, Longieren oder Bodenarbeit, denn schon kleinste Fehlstellungen oder Druckpunkte können langfristig zu Überlastungen führen. Die Ausrüstung sollte immer überprüft werden: Gamaschen und Bandagen dürfen nicht einschneiden oder zu eng anliegen. Ein weiterer Baustein der Prävention ist die Ernährung. Eine ausgewogene Versorgung mit Mineralstoffen, Spurenelementen und Gelenkbausteinen unterstützt das Bindegewebe und die Gelenkgesundheit, ersetzt aber keinesfalls eine durchdachte Trainings- und Haltungsstrategie.
Mehr Infos zur Anatomie und Biomechanik des Pferdes:

Mehr über Faszien des Pferdes und Faszientraining: